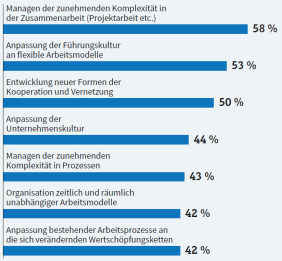Neue digitale Geschäftsmodelle erschließen
Leitfäden für Innovation
von Thomas Hafen - 27.07.2017
Es gibt eine Reihe weiterer Methodenkonzepte, die Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle helfen sollen und die alternativ oder ergänzend zum Design Thinking eingesetzt werden können. Die bekanntesten sind der am St. Galler Institut für Technologiemanagement entwickelte Business Model Navigator und die Business Model Canvas von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur (siehe auch Kasten auf Seite 16). Nach Ansicht von Alexander Thamm, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Data-Science-Beratung, sind die Konzepte vor allem für den Einstieg in das Thema sinnvoll, weil sie auf den Grundideen der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle beruhen: „Schneller Produktiveinsatz, häufiges Testen, kurze Update-Zyklen – diese Basisgedanken sind in den Methoden verankert und zwingen die Anwender, in die richtige Richtung zu denken.“
Wenn Unternehmen bereits Erfahrungen in der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle gesammelt haben, könne man sich laut Thamm aber auch wieder ein Stück weit von den starren Vorgaben entfernen. Ein Erfolgsgarant seien sie ohnehin nicht. „Nur weil ich eine Business Model Canvas ausdrucke und brav ausfülle, heißt das noch lange nicht, dass ich damit erfolgreich bin, solange ich nicht auch mein Denken verändert habe.“
Testen, testen, testen!
Anders als die traditionelle Produktentwicklung beziehen die modernen Konzepte die potenzielle Zielgruppe bereits in den Designprozess mit ein. „Man muss sich möglichst früh Gedanken über den Kundennutzen machen und seine Annahmen an der Realität überprüfen, statt zwei Jahre im stillen Kämmerlein an einem Produkt herumzuentwickeln, das am Ende keiner braucht“, sagt Alexander Thamm. Der Kontakt mit der Wirklichkeit ist deshalb auch essenzieller Bestandteil der Design-Thinking-Workshops von Anna Milaknis: „Wir gehen vor, während und nach einem Workshop auf die Straße und reden mit den Leuten.“
Thamm erklärt an einem Beispiel, wie wichtig diese frühen Phasen der Evaluierung sind: „Wir hatten die Idee, ein Navigationssystem für die Leihfahrräder der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG zu entwickeln, das Touristen unterschiedliche Stadtrundfahrten anbieten sollte.“ Zentraler Bestandteil des ersten Entwurfs war eine große Straßenkarte für die Routenplanung. Beim Test mit potenziellen Nutzern zeigte sich aber schnell der Schwachpunkt dieser Lösung: „Die meisten unserer Testpersonen befürchteten, durch die kleinteilige Karte zu sehr vom Verkehrsgeschehen abgelenkt zu werden und bevorzugten große, deutliche Richtungsweiser auf dem Display.“ Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, musste Thamm noch nicht einmal einen Prototypen bauen. „Wir haben die App auf einen Pappkarton gemalt, das darf einem nicht peinlich sein.“
Perioden kreativer Entwicklung und Testphasen wechseln sich im Design-Thinking-Prozess, aber auch bei den anderen Konzepten mehrfach ab. Ziel dieses iterativen Vorgehens ist es, möglichst schnell zu einem Minimum Viable Product zu kommen – einem rudimentären Produkt oder Service, das oder der Kunden angeboten werden kann. „Die Beta-Phasen werden viel länger, die Produkte werden heute gemeinsam mit den Nutzern zu Ende entwickelt“, so Herch.
Schöner scheitern
Das frühe und häufige Testen führt dazu, dass Vorstellungen und Annahmen immer wieder aufgegeben oder angepasst werden müssen. „Man darf nicht zu sehr Fan der eigenen Idee sein“, sagt Thamm. Ein Ansatz, der in deutschen Unternehmen nach wie vor unbeliebt sei. „Hierzulande werden Projekte meist risikominimierend konzipiert. Man rechnet so lange Business-Cases rauf und runter, bis man einen findet, der mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit funktioniert.“
Diese Vorsicht hängt laut Thamm unter anderem mit den negativen Folgen des Scheiterns zusammen, die viele Mitarbeiter fürchten: „Gerade im mittleren Management sind Risiken unbeliebt. Wer scheitert, dem droht ein Karriereknick, bei Erfolg gibt es ein Schulterklopfen – und dann geht es weiter mit dem operativen Geschäft.“ Dabei gehöre Misserfolg unbedingt dazu, um sich weiterzuentwickeln. „Ich kenne keinen erfolgreichen Gründer, der nicht schon mehrfach auf die Nase gefallen ist.“
Thamm selbst ist da keine Ausnahme: Sein erster Versuch als Gründer – ein Internetcafé, das er mit 18 Jahren eröffnete – war ebenso wenig erfolgreich wie eine Karriere als Versicherungsmakler, die er während des Studiums begann. „Diese ganzen Erfahrungen waren wichtig, um eine Firma erfolgreich aufbauen zu können und zu wissen, wo man aufpassen muss.“ Thamm empfiehlt den Besuch von sogenannten Fuckup Nights, in denen Start-ups erzählen, was schiefgelaufen ist. „Daraus kann man viel mehr lernen als aus tollen, im Nachhinein meist auch noch ausgeschmückten Erfolgsgeschichten.“