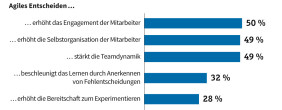Zwischen Mode und Notwendigkeit
Der lange Weg zum agilen Unternehmen
von
Thomas
Hafen - 01.02.2019

Foto: Jesus Sanz / shutterstock.com
Um den digitalen Wandel zu überleben, müssen Unternehmen ihre Firmenkultur verändern. Ein sinnvoller Ansatz ist die agile Arbeitsweise. Ein Allheilmittel ist das jedoch nicht.
Fachwissen, Erfindungsreichtum, Ingenieurskunst und sorgfältige Planung sind die Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg, davon sind gerade in Deutschland viele Unternehmenslenker überzeugt.
Doch langsam machen sich auch unter ihnen Zweifel breit. Neue Geschäftsmodelle und Wettbewerber tauchen wie aus dem Nichts auf und fegen Traditionsunternehmen vom Markt. „Die Digitalisierung führt zu veränderten Kundenbedürfnissen und Markterfordernissen, die Komplexität nimmt zu“, bringt Svenja Hofert den grassierenden Wandel auf den Punkt. Sie bietet als Geschäftsführerin der Teamworks GTQ GmbH (Gesellschaft für Teamentwicklung und Qualifizierung) unter anderem Workshops zu agilem Führen an und hat schon mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben.
Kompliziert oder komplex?
Um die besonderen Herausforderungen komplexer Umgebungen zu verstehen, wie sie heute in Wirtschaft und Industrie vorherrschend sind, können Konzepte wie das „Cynefin Framework“ helfen, das der britische Berater und Wissenschaftler Dave Snowden entwickelt hat. Es unterscheidet prinzipiell zwischen einfachen, komplizierten, komplexen und chaotischen Zuständen und gibt für jeden Bereich Managementempfehlungen.
Einfache Szenarien zeichnen sich demnach durch klare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aus. Sie lassen sich durch simple Rezepte lösen. „Für eine einfache Aufgabe brauche ich keine lange Planungsphase“, erklärt Daniel Dubbel, Senior-Berater für Arbeit 4.0, Agilität und Projektmanagement bei DB Systel. In Unternehmen stellen einfache Szenarien Mitarbeiter und Führungskräfte nicht vor große Herausforderungen. Abweichungen vom Sollzustand lassen sich leicht identifizieren, kategorisieren und mit den in der Vergangenheit gesammelten Erfahrungen lösen.
Auch bei komplizierten Problemen gibt es einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, er ist jedoch nicht so offensichtlich und kann sich über viele Zwischenstufen erstrecken. Snowden nennt dies das „Reich der bekannten Unbekannten“. Herausforderungen lassen sich nicht einfach kategorisieren und nach Schema F abarbeiten, sie müssen diagnostiziert und analysiert werden. Auch kann es mehrere richtige Antworten und geeignete Wege zum Ziel geben.
Die Lösung komplizierter Probleme durch Ingenieure und andere Experten ist wiederum typisch für die industrielle Revolution, die im 18. Jahrhundert begann und sich über die zunehmende Elektrifizierung und Mechanisierung der Produktion bis hin zur Entwicklung der Mikroelektronik im 20. Jahrhundert fortsetzte. Dampfmaschinen, automatische Webstühle und Automobile sind einige der Beispiele für komplizierte Maschinen. Einfache und komplizierte Aufgaben werden nach Ansicht von Daniel Dubbel zukünftig überwiegend von Maschinen erledigt werden: „Roboter können beispielsweise Autos viel schneller und effizienter zusammenbauen als Menschen am Fließband.“
Während es bei komplizierten Fragestellungen mindestens eine richtige Antwort gibt, ist dies in komplexen Umgebungen anders. Dave Snowden nennt als Beispiel den Unterschied zwischen einem Ferrari und dem brasilianischen Regenwald: Das Auto lässt sich in seine Einzelteile zerlegen und mit der notwendigen Erfahrung wieder zu einer funktionsfähigen Einheit zusammensetzen. Der brasilianische Regenwald funktioniert dagegen nur als Ganzes.
Die Wechselwirkungen der einzelnen Bestandteile sind komplex, eine Vorhersage, welche Auswirkungen das Aussterben einer Art, die Abholzung eines Gebiets oder der Klimawandel auf das Gesamtsystem haben wird, ist nicht etwa nur schwer zu treffen – sie ist vielmehr schlichtweg unmöglich. „Je komplexer die Anforderungen, desto weniger funktionieren herkömmliche Planungstechniken und Managementkonzepte“, erklärt Svenja Hofert von Teamworks GTQ.
Umweltkatastrophen, Flugzeugabstürze und andere Krisen sind dagegen typische Fälle für chaotische Systeme. Während selbst in komplexen Umgebungen Ursache und Wirkung in einem geordneten Zusammenhang stehen, ist dies im Chaos nicht mehr der Fall. Hier geht es im Wesentlichen darum, Schaden zu begrenzen und Handlungsfähigkeit wiederherzustellen. Krisenmanagement erfordert entschlossenes Handeln, klare Anweisungen und direkte Kommunikation. Diskussionen oder das Hinterfragen von Entscheidungen ist erst in der Nachschau möglich und sinnvoll.